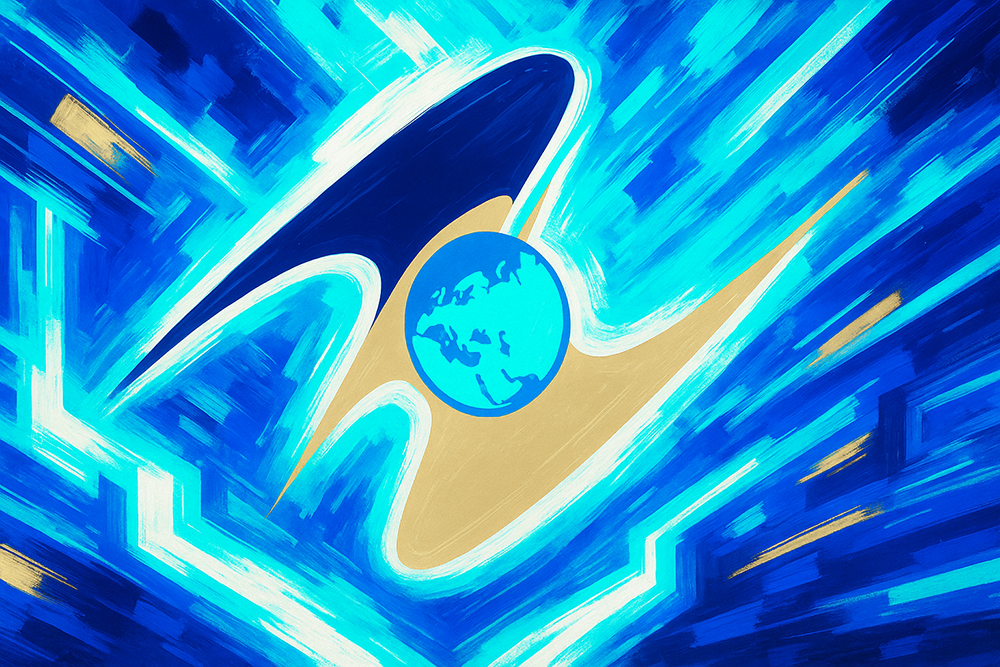Pragmatischer Eurasismus. Vier Ansätze zum besseren Verständnis der Eurasischen Wirtschaftsunion
_ J.C. Kofner, damals Leiter des Eurasischen Sektors am Zentrum für umfassende internationale und europäische Studien der Higher School of Economics (Nationale Forschungsuniverstität) in Moskau. Der Beitrag wurde am 15. März 2019 zum fünfjährigen Jubiläeum der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) beim Journal „New Eastern Europe“ veröffentlicht, welches vom Jan Nowak-Jeziorański College für Osteuropa in Breslau, Polen herausgegeben wird.
***
Im Mai 2019 feiern wir das fünfte Jubiläum der Unterzeichnung des Vertrags über die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) und das 25-jährige Jubiläum der Idee der modernen eurasischen Integration. Seitdem hat sich die Eurasische Wirtschaftsunion als ein ziemlich erfolgreich entwickelnder, offener und attraktiver Integrationsblock etabliert, der tatsächlich zur unbestreitbaren Realität der wirtschaftlichen Prozesse in Eurasien geworden ist. Vielleicht ist genug Zeit vergangen, sodass wir beginnen können, über eine „Theorie der eurasischen Integration“ an sich nachzudenken und deren potenziellen Inhalt zu skizzieren.
Am wichtigsten ist, dass die Eurasische Wirtschaftsunion, die erstmals 1994 nicht von Moskau, sondern vom kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew vorgeschlagen wurde, immer noch in erster Linie zwischenstaatlicher Natur ist und eine rein wirtschaftliche Agenda hat. Nach dem Vertrag über die EAWU besteht ihr übergeordnetes Ziel darin, ein Umfeld zu schaffen, das die Realisierung des Potenzials wirtschaftlicher Verbindungen innerhalb der Region, die Modernisierung der nationalen Volkswirtschaften und die Steigerung der globalen Wettbewerbsfähigkeit begünstigt. Der Kern der eurasischen Integration ist der Binnenmarkt für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräfte. Zum ersten Mal in der Geschichte ist die EAWU eine vollständig friedliche, freiwillige sowie – man könnte argumentieren – demokratische, gleichberechtigte und marktwirtschaftliche Vereinigung der Länder und Völker des eurasischen Raums.
Angesichts dieser Ziele sollte die Theorie der modernen eurasischen Integration „pragmatischer Eurasismus“ genannt werden, da sie einen rein pragmatischen Ansatz zum Aufbau der Integration verfolgt. Vollkommen pragmatische wirtschaftliche Zielsetzung, nicht ideologischer Inhalt, z. B. im Gegensatz zum Konzept des Föderalismus in der Integrationstheorie, nimmt in der Formulierung des EAWU-Vertrags und der Logik des Aufbaus der Institutionen der eurasischen Integration eine zentrale Stellung ein.
Wiedervereinigung wegen Krise: Holding-together-Integration
Um die Logik der eurasischen Integration zu erklären, bieten der Soziologe der Ludwig-Maximilians-Universität Alexander Libman und der Direktor des Zentrums für Integrationsstudien der Eurasischen Entwicklungsbank Evgeny Vinokurov die Theorie der Holding-together-Integration (2012) an. Holding-together-Integration ist regionale Integration, die von einer Gruppe von Ländern initiiert wird, die bis vor kurzem Teil eines einheitlichen Staates oder eines Kolonialreiches waren und enge wirtschaftliche, politische und kulturelle Verbindungen aufrechterhalten.
Erstens hilft die Holding-together-Integration, ein bestimmtes Maß an wirtschaftlicher und politischer Kohäsion zwischen neu unabhängigen Staaten aufrechtzuerhalten – entweder auf unbestimmte Zeit oder für einen begrenzten Zeitraum (wodurch der Trennungsprozess weniger kostspielig und schmerzhaft wird).
Zweitens kann Holding-together-Integration auch eine Kehrtwende einleiten: starke Desintegration nach der Auflösung des einheitlichen Staates, gefolgt von einer Reintegration auf Grundlage zwischenstaatlicher Zusammenarbeit, neuer Prinzipien, verschiedener Mechanismen und möglicherweise eines überarbeiteten Mitgliederkreises. Während Perioden wirtschaftlichen Wohlstands können Länder symbolische Schritte unternehmen, um eine nationale Identität zu schaffen, aber eine wirtschaftliche Flaute macht die Kosten des Nation-Building prohibitiver. Im Allgemeinen kann regionale Integration dieser Art ein Integrationsprojekt sein, das durch eine Krise notwendig wird: ein wirtschaftlicher Abschwung kann die Zusammenarbeit zwischen Ländern fördern. In einer ungünstigen wirtschaftlichen Situation ist es wahrscheinlicher, dass tiefgehende wirtschaftliche Verbindungen zwischen neu unabhängigen Staaten gestärkt werden als deren Verbindungen zu Drittländern.
Es ist zu beachten, dass die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (EurAsEC) formell im Jahr 2000 gegründet wurde, als Vladimir Putin an die Macht kam. Die EurAsEC-Zollunion, das alles entscheidende Vorläuferprojekt der EAWU, wurde jedoch erst 2010 gegründet, nachdem ein Jahrzehnt hoher Ölpreise und eines zuversichtlichen BIP-Wachstums in Russland, Kasachstan und Belarus zu Ende gegangen war. Die Führer dieser Länder verpflichteten sich erst nach der globalen Wirtschaftskrise und dem Beginn einer Phase politischer Instabilität im postsowjetischen Raum – ein Phänomen, das vom Kreml als „Farbrevolutionen“ bezeichnet wird – ernsthaft zur eurasischen Integration.
Russlands Interesse verstehen: Kooperative Hegemonie
Aus der Sicht des realistischen Ansatzes sind Integrationsprozesse eher schwer zu erklären, da sich die Frage stellt, warum eine Großmacht, in unserem Fall Russland, sich an einen externen institutionellen Rahmen (die Spielregeln) bindet, indem sie an Prozessen regionaler Integration mit kleineren Staaten teilnimmt. Um dieses Phänomen zu erklären, bietet der dänische Politikanalyst von der Aarhus University Thomas Pedersen in seinem Artikel „Cooperative Hegemony. Power, ideas and institutions in regional integration“ (2002) die Theorie der kooperativen Hegemonie an, die über die Analyse der europäischen Erfahrung hinausgeht.
Kooperative Hegemonie ist eine Art regionaler Ordnung, innerhalb derer weiche Kontrolle durch Kooperationsabkommen auf der Grundlage einer langfristigen Strategie ausgeübt wird. Es ist nur eine von vier weiteren möglichen Strategien der Großmächte, und die Wahl kann auch zugunsten einer einseitigen Hegemonie, des Aufbaus eines Imperiums oder eines „Konzerts“ erfolgen. Kooperative Hegemonie kann als verbindlicher „Vertrag“ zwischen dem regionalen Zentrum, d. h. Russland, und der Peripherie, d. h. den anderen EAWU-Mitgliedstaaten, verstanden werden: Der erste stimmt einigen Präferenzen zu und übt eine gewisse Selbstbeschränkung aus, im Gegenzug für die Loyalität des zweiten.
Mein Freund der Staat: Liberaler Intergouvernementalismus
Der liberale Intergouvernementalismus erklärt die Natur der EAWU sehr gut. Die neu unabhängigen Staaten des postsowjetischen Raums, die gerade erst aus einem hochzentralisierten und einheitlichen Staat (der UdSSR) hervorgegangen sind, schätzen ihre Souveränität und nationale Identität sehr.
Wie der Intergouvernementalismus betont auch der liberale Intergouvernementalismus nationale Regierungen als zentrale Akteure im Integrationsprozess und betrachtet supranationale Institutionen als von begrenzter Bedeutung für den Integrationsprozess. Gleichzeitig integriert er das liberale Modell der Präferenzbildung, wobei nationale Regierungen, wie die EAWU-Mitgliedstaaten, eine klare Vorstellung ihrer Präferenzen haben und diese in Verhandlungen mit anderen Mitgliedstaaten verfolgen. Liberale Intergouvernementalisten argumentieren, dass die Verhandlungsmacht der Mitgliedstaaten für die Verfolgung der Integration wichtig ist, und dass Paketlösungen und Nebenleistungen ebenfalls im Prozess der Entscheidungsfindung auftreten. Sie sehen die multilaterale Institution als Mittel zur Schaffung glaubwürdiger Verpflichtungen der teilnehmenden Regierungen, d. h. als Weg, sicherzustellen, dass die anderen Regierungen, mit denen sie Vereinbarungen treffen, ihren Teil der Abmachung einhalten. Darüber hinaus sehen insbesondere die nationalen Regierungen der kleineren Mitgliedstaaten – Armenien und Kirgisistan – die Vorteile der eurasischen Integration als ein praktikables Mittel, ihre sozialen und wirtschaftlichen Verpflichtungen gegenüber ihren Bevölkerungen umzusetzen.
Der liberale Intergouvernementalismus ist eine Weiterentwicklung der intergouvernementalen Theorie der europäischen Integration, die vom amerikanischen Professor an der Princeton University Andrew Moravcsik in seinem Buch The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht (1998) etabliert wurde. In den 1990er Jahren war sie die dominierende Theorie der europäischen Integration.
Laut den Rechtswissenschaftlern der Moskauer Higher School of Economics Kirill Entin und Maksim Karliuk kann bereits im engeren Sinne von einem „Acquis der Eurasischen Wirtschaftsunion“ gesprochen werden. Es kann jedoch einige Vorbehalte oder Zweifel hinsichtlich dieses Statements geben, da das Feld der ausschließlichen Zuständigkeit der EAWU und die Befugnisse der Eurasischen Wirtschaftskommission (EEC) begrenzt bleiben – hauptsächlich im Handel mit Drittländern, bei technischen Vorschriften sowie bei sanitären, phytosanitären und veterinärmedizinischen Maßnahmen, Anti-Dumping und grenzüberschreitendem Wettbewerb. Außerdem, obwohl die Entscheidungen der Kommission unmittelbar anwendbar sind, fehlen der Kommission oft die notwendigen Instrumente, um die Einhaltung der Verpflichtungen der EAWU-Länder auf nationaler Ebene sicherzustellen. Die EEC kann bei Nichterfüllung von Verpflichtungen vor dem Gericht keine Sanktionen verhängen. Dieses „Integrationshandicap“ schafft einen umfangreichen Bereich für Verstöße, die wiederum die Integration untergraben.
Ein weiteres Handicap ist das Fehlen des Vorabentscheidungsverfahrens im Instrumentarium des Gerichts der Eurasischen Wirtschaftsunion – ein Instrument, das maßgeblich zur Entwicklung des EU-Rechts beigetragen hat. Und obwohl das Gericht in seinen Urteilen und Gutachten die Bestimmungen des EAWU-Vertrags auslegt, sind die Akte des EAWU-Gerichts formell nicht in der Vorstellung des EAWU-Rechts, wie es im Vertrag formuliert ist, enthalten.
Zum Vergleich: Das Acquis der EU (früher als „acquis communautaire“ bekannt, oder „durch die Gemeinschaft erworben“) ist die Gesamtheit der Gesetzgebung, Rechtsakte und Gerichtsentscheidungen, die den Körper des EU-Rechts bilden. Während des Erweiterungsprozesses der Europäischen Union 2004–2007 wurde das Acquis in 31 Kapitel unterteilt, um Verhandlungen zwischen der EU und den Beitrittskandidaten zu erleichtern. Bevor ein neues Mitgliedsland der Union beitritt, muss es einen erheblichen Teil des EU-Acquis übernehmen und umsetzen.
Trotz dieser Einschränkungen transformiert sich das EAWU-Recht zunehmend zu einem autonomen Rechtssystem, da das EAWU-Gericht in seinen Akten festgestellt hat, dass die Bestimmungen des EAWU-Vertrags Vorrang vor nationalem Recht haben und, sofern sie Rechte oder legitime Interessen für Einzelpersonen begründen und hinreichend klar und präzise sind, auch unmittelbare Wirkung entfalten, d. h. sie können vor nationalen Gerichten geltend gemacht werden.
Nach diesen Beobachtungen ist es notwendig, die zwischenstaatliche Komponente der EAWU zu stärken, den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, Wirtschaftspolitiken in Fragen abzustimmen, die nicht auf supranationaler Ebene übertragen wurden, und getrennte Abkommen zu vermeiden. Heute erfolgt die eurasische zwischenstaatliche Koordination auf der Ebene der stellvertretenden Ministerpräsidenten, die den Rat der Eurasischen Wirtschaftskommission bilden, der nur einmal im Monat tagt. Das ist eindeutig nicht ausreichend. Diese Koordination sollte auf die Ebene der Ministerien und Abteilungen aller EAWU-Länder ausgeweitet werden. Ähnlich dem Ausschuss der Ständigen Vertreter (COREPER) der EU sollte zudem eine Institution der ständigen Vertreter innerhalb der Union eingerichtet werden, die ihre gesamte Zeit der zwischenstaatlichen Koordination widmet. Darüber hinaus lohnt es sich, die Befugnisse der bestehenden Organe der EAWU – der EEC und des EAWU-Gerichts – gemäß den bereits vereinbarten Regeln zu stärken.
Rache des Herzlands: Geookonomischer Determinismus
Ein weiteres einzigartiges Merkmal der eurasischen Integration, wie vom Chefvolkswirt der EDB, Yaroslav Lissovolik, hervorgehoben, ist das Ergebnis der tellurokratischen Geographie der Region. Es gibt eine beispiellose Entfernung des Hinterlands/Herzlands von Groß-Eurasien, auf dem der größte Teil des EAWU-Gebiets liegt, von den Weltmeeren und damit von internationalen Märkten. Vier von fünf EAWU-Mitgliedstaaten sind Binnenstaaten: Kasachstan ist der größte Binnenstaat der Welt. Belarus ist der größte Binnenstaat Europas. Kirgisistan ist nicht nur Binnenstaat, sondern liegt auch auf einer der höchsten Höhen über dem Meeresspiegel weltweit. Armenien ist der einzige Staat Westasiens ohne Zugang zu einem nennenswerten Gewässer.
Angesichts der höheren Transportkosten, denen Binnenwirtschaften ausgesetzt sind, sind sie weniger wettbewerbsfähig, da Importe und Exporte teurer sind. Laut der Weltbank haben Binnenstaaten im Durchschnitt 30 Prozent geringeren Handelsumsatz als Länder mit Zugang zum Meer; Kontinentalität reduziert die Wachstumsrate eines Landes im Vergleich zu Küstenstaaten um 1,5 Prozent. Die Gründung der Eurasischen Wirtschaftsunion kann daher als Antwort auf dieses geografische Problem gesehen werden, da die EAWU eine entscheidende Rolle dabei spielt, den Mitgliedern den Zugang zu internationalen Märkten durch die Senkung von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen sowie durch die Förderung der Verkehrsanbindung durch die Schaffung eines gemeinsamen Verkehrsraums zu erleichtern.
Es ist bemerkenswert, dass ähnliche Aussagen zum geookonomischen Determinismus Eurasiens bereits von den klassischen Eurasisten – dem Ökonomen Peter Sawizki (1921) und dem Philologen Nikolai Trubetzkoi (1933) – gemacht wurden, was dieses Argument für den pragmatischen Eurasismus mit dem klassischen verbindet.
Haftungsausschluss
Die in dieser Veröffentlichung geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und geben nicht die Position irgendwelcher zugehöriger oder erwähnter Personen oder Organisationen wieder.